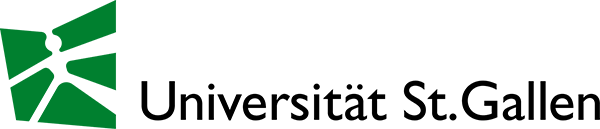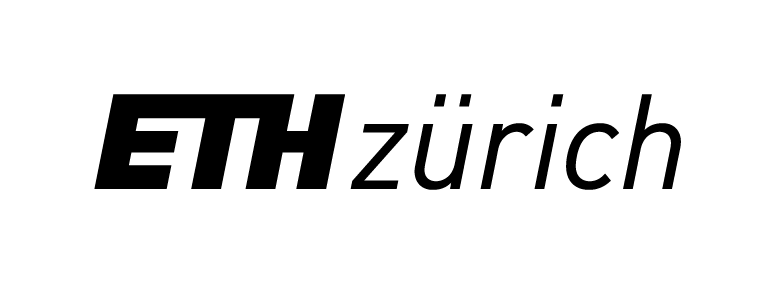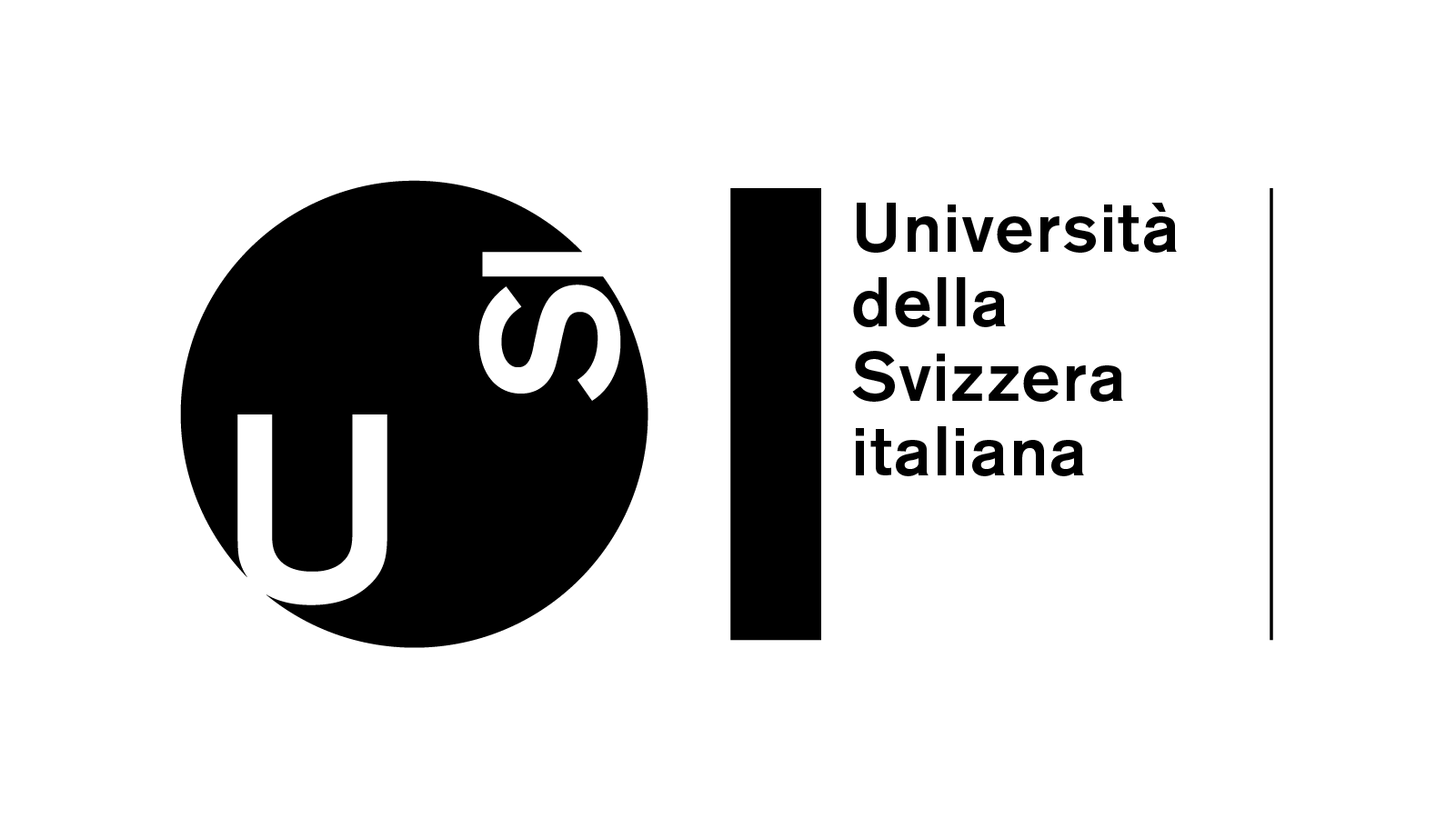Doktorat und First-Gen Academics
Nach Abschluss eines Masterstudiums haben die Studierenden die Wahl, die akademische Welt zu verlassen und eine berufliche Laufbahn einzuschlagen und später eventuell ihre Kenntnisse und Fähigkeiten mithilfe verschiedener Weiterbildungsangeboten (CAS, DAS, MAS, MBA usw.) zu vertiefen.
Alternativ können sie mit einer Doktorarbeit den Doktortitel erwerben; den höchsten Titel, der von Universitäten vergeben wird. Dieser Titel ist für alle, die eine akademische Laufbahn einschlagen möchten, unerlässlich. Er kann auch einen wichtigen Trumpf für Führungspositionen im öffentlichen oder privaten Sektor darstellen. Mit einer durchschnittlichen Dauer von vier bis fünf Jahren erfordert die Dissertation einen erheblichen persönlichen Einsatz und bedarf einer gewissen Vorbereitung, da der Zugang zu einem Postgraduiertenstudium in der Regel über eine Bewerbung erfolgt.
Warum ein PhD?
Eine Dissertation ist weit mehr als ein akademisches Projekt, sie ist eine professionalisierende Erfahrung, um Know-how und anerkanntes Fachwissen in einem Bereich zu erwerben. Für First-Generation Students, die oft kein familiäres Vorbild in diesem Studiengang haben, ist die Dissertation eine Chance, eine lohnende Karriere aufzubauen, sowohl innerhalb als auch ausserhalb des universitären Umfelds.
Jede Dissertation ist eine einzigartige Erfahrung, die die Möglichkeit bietet, Wissen, ein Netzwerk sowie methodische und soziale Kompetenzen zu entwickeln, die für den weiteren Werdegang der Studierenden von entscheidender Bedeutung sind. Diese Vorteile sind für First-Generation Students wertvoll, da sie ihnen vielfältige Optionen bieten, ohne von familiären Kontakten in diesen Bereichen abhängig zu sein.
Die Promotion bleibt jedoch ein langfristiges, einsames Projekt, das ein hohes Mass an persönlicher Investition und Disziplin erfordert. Man muss in der Lage sein, sich an Tiefpunkten wieder aufzurichten und Geduld zu haben, da sich die Ergebnisse erst mittel- bis langfristig bemerkbar machen. Es ist auch wichtig, sich Gedanken über die Finanzierung der Dissertation zu machen und während des gesamten Prozesses auf die eigene körperliche und geistige Gesundheit zu achten. Die Einzigartigkeit der Promotionserfahrung macht sie für Personen, die sie nicht selbst erlebt haben, schwer fassbar; daher ist die Gemeinschaft von Forscher*innen und Forschern, in der die Promotion stattfindet, eine wichtige Stütze für Doktorand*innen, insbesondere für First-Generation Students.
Abgesehen von allen Überlegungen zu möglichen beruflichen Möglichkeiten sollte die Entscheidung für eine Dissertation vor allem durch das Interesse am Forschungsthema motiviert sein, das Jahr für Jahr spannend bleiben muss.
Zulassungsverfahren
Die Zugangsvoraussetzungen für die Promotion sind je nach Universität und manchmal auch je nach Fakultät etwas unterschiedlich, daher sollten Sie sich vorab bei der gewünschten Einrichtung erkundigen. Die Grundvoraussetzungen sind jedoch: ein Masterabschluss – oder ein als gleichwertig erachteter Titel – im Forschungsbereich der Dissertation, und die vorherige Zustimmung der betreuenden Person der Dissertation. Weitere Bedingungen können hinzukommen, z. B. eine Mindestnote für die Masterarbeit oder für das gesamte Studium.
An einigen Fakultäten – insbesondere an der Medizinischen Fakultät – gelten besondere Bedingungen, über die Sie sich vorab informieren sollten.
Links : EPFL, ETHZ, HSG, UniBe, UniFr, UniGe, UniLu, UniNe, USI, UZH
Vorbereitung auf ein Doktorat
Wenn die Motivation, eine Dissertation zu beginnen, feststeht, kann es spannend sein, sich mit anderen Doktorand*innen, Mitgliedern des Mittelbaus oder Professor*innen des Fachbereichs zu unterhalten, um sich über
- die Besonderheiten der Doktorarbeit,
- die Modalitäten der Betreuung der Dissertation,
- die wissenschaftlichen Interessen der vorgeschlagenen Betreuungsperson,
- die Struktur der Anstellung (Sektion, Abteilung, Institut) und ihre Arbeitsbedingungen,
- die Finanzierung der Dissertation,
- die durchschnittliche Dauer der Dissertation im Forschungsbereich,
- die Bedingungen für den Zugang zum Doktorat und die Anforderungen für die Verleihung des Doktortitels sowie
- die Möglichkeiten für Weiterbildungen während der Dauer der Dissertation zu informieren.
Auch wenn es nicht einfach ist, ein „gutes“ Thema für eine Dissertation zu definieren, muss es wissenschaftlich durchführbar sein und einen originellen Beitrag in seinem Bereich darstellen. Um dies zu erreichen, ist es entscheidend, die aktuellen Bedürfnisse des angestrebten Wissenschaftsbereichs zu verstehen, was eine gründliche Vorrecherche und einen Austausch mit der zukünftigen Dissertationsbetreuung voraussetzt.
Einige Themen werden in geförderten Forschungsprojekten vorgegeben; in diesem Fall wird das Projekt häufig von spezifischen Ressourcen begleitet. Die Wahl eines Themas, das auch für den*die Betreuer*in von Interesse ist, erleichtert die Betreuung und die Integration in bestehende Forschungsprogramme. Für First-Generation Students bietet ein solches Thema und der Zugang zu einem Netzwerk von Forscher*innen eine zusätzliche Unterstützung.
Before you begin your doctorate
Ablauf des Doktorats
Die Erstellung einer Dissertation umfasst mehrere Schritte: Formulierung der Fragestellung, Erstellung der Bibliografie, Sammlung und Analyse der Daten, Verfassen, Korrekturlesen und schliesslich das Drucken des Manuskripts. Diese oft ineinander übergehenden Schritte variieren je nach Fachrichtung und Format (Monografie oder Dissertation in Artikeln) in Dauer und Tiefe.
Jede Fakultät schreibt auch spezifische regulatorische Schritte vor, wie die Einreichung des Dissertationsprojekts, die sich von Institution zu Institution unterscheiden. Schliesslich umfasst der Prozess der Verteidigung verschiedene administrative Schritte (Fristen, Einreichung der Manuskripte, Zusammensetzung der Jury), die langwierig sein können; für eine erfolgreiche Organisation ist es daher ratsam, frühzeitig zu planen und die Juror*innen zu kontaktieren.
Unabhängig von den Besonderheiten der Disziplinen ist eine der grössten Herausforderungen für Doktorand*innen das Zeitmanagement: Sie müssen im Laufe der Monate einen Rhythmus beibehalten, sich mit Blockaden auseinandersetzen und wissen, wie sie die Entwicklungsschwerpunkte ihrer Forschung priorisieren können. Normalerweise wird man von der Betreungsperson unterstützt, aber es ist oft unerlässlich, sich mit anderen Doktorand*innen oder erfahreneren Kollegen zu umgeben, um nicht entmutigt zu werden. Die Unterstützung von Freunden oder der Familie hilft auch dabei, ein für die geistige Gesundheit unerlässliches Sozialleben aufrechtzuerhalten und daran zu denken, dass die Dissertation kein Lebenswerk ist, sondern ein Schritt nach vorn.
Links: EPFL, ETHZ, HSG, UniBe, UniFr, UniGe, UniLu, UniNe, USI, UZH
Beruflichen Aussichten und akademisch Karrieren
Nach einem Doktorat stehen jungen Forscher*innen mehrere Wege offen. In der akademischen Welt können sie eine Stelle als Postdoktorand*in, Oberassistent*in oder Professor*in anstreben, wobei diese kompetitiven Laufbahnen Veröffentlichungen, Forschungsprojekte und die Teilnahme an Kolloquien erfordern. Die akademische Laufbahn ist oft mit Mobilität verbunden, um das Netzwerk zu erweitern und Erfahrungen zu sammeln.
Ausserhalb der Universitäten sind Doktorand*innen aufgrund ihrer analytischen Fähigkeiten und ihres Projektmanagements gefragt. Sie finden in den verschiedensten Bereichen Beschäftigung: Forschung und Entwicklung, Beratung, Wissenschaftskommunikation, öffentliche Verwaltung und sogar im Management und in der Innovationsbranche.
Die während der Promotion erworbenen Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit werden in diesen Kreisen geschätzt und ermöglichen einen vielfältigen und dynamischen Berufseinstieg. First-Gen-Studierende können von Mentoring- und beruflichen Entwicklungsinitiativen profitieren, die ihre Integration erleichtern und eine erfolgreiche Eingliederung in verschiedene Laufbahnen ermöglichen.
Finanzierung des Doktorats
Ein Überblick über die wichtigsten Finanzierungsmöglichkeiten für eine Doktorarbeit an Schweizer Universitäten und Hochschulen:
- Assistenzstellen: Doktorierende können als wissenschaftliche oder Lehrassistent·innen angestellt werden. Diese Position ermöglicht es, eine Dissertation zu verfassen und gleichzeitig aktiv am akademischen Leben der Fakultät teilzunehmen. Ein Teil des Beschäftigungsgrads ist der Arbeit an der Dissertation gewidmet (dieser Anteil variiert je nach Institution).
- Schweizerischer Nationalfonds (SNF): Der SNF finanziert Doktoratsstellen im Rahmen freier Forschungsprojekte. Die Stipendien decken Löhne, Forschungskosten und Mobilität. Einzelstipendien (Doc.CH) wurden im Jahr 2024 abgeschafft.
- Kofinanzierte Dissertationen durch private Mittel: In bestimmten Fällen können Doktorierende durch Unternehmen oder private Stiftungen finanziert werden. Diese gesponserten Dissertationen beinhalten teilweise eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und bieten eine direkte Verbindung zur Industrie. Die Universität betreut und validiert das Projekt, die Finanzierung stammt jedoch grösstenteils von externen Akteuren.
- Doktoratsprogramme und Graduiertenschulen: Einige Universitäten bieten Stipendien im Rahmen von strukturierten Doktoratsprogrammen oder Graduiertenschulen an, die finanzielle Unterstützung und eine strukturierte Betreuung gewährleisten.
- Regionale Förderungen und private Stiftungen: Verschiedene private Stiftungen und kantonale Förderungen finanzieren Dissertationen in spezifischen Themenbereichen, teilweise mit Fokus auf vielfältige Profile. Diese Stipendien stellen in der Regel keine Löhne dar, weshalb keine Sozialversicherungen (Arbeitslosigkeit, AHV, IV usw.) enthalten sind. Sie werden meist einmalig mit einem festen Betrag vergeben.
Unabhängig von der gewählten Finanzierungsform können Doktorierende Mobilitätsbeiträge für nationale oder internationale Aufenthalte beantragen. Diese Beiträge ermöglichen in der Regel ein Semester, gelegentlich zwei, an einer Partnerinstitution mit dem Ziel, das akademische Netzwerk und die Kompetenzen zu stärken.
Links : EPFL, ETHZ, FNS, Fundraiso, HSG, UniBe, UniFr, UniGe, UniLu, UniNe, UZH